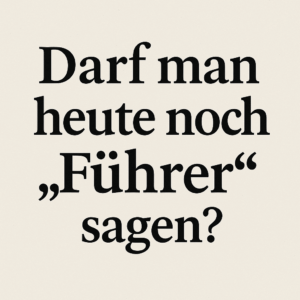
Führen heißt bewegen: Warum wir den Begriff „Führer“ nicht den Diktaturen überlassen sollten
In der vorliegenden Untersuchung wird bewusst der Begriff „Führer“ verwendet – anstelle der im deutschen Sprachgebrauch zunehmend dominierenden Anglizismen wie Leader, Leadership oder deren Ableitungen. Diese Wahl erfolgt nicht zufällig, sondern gründet auf begriffsgeschichtlichen, juristischen und sprachwissenschaftlichen Überlegungen.
Etymologische Herkunft: Vom althochdeutschen fuoren
Der Begriff Führer leitet sich aus dem althochdeutschen fuoren („bewegen, lenken, führen“) ab und besitzt in seiner Grundbedeutung keine ideologische oder politische Konnotation. Die substantivische Form des „Führers“ ist in der deutschen Sprache tief verankert – in funktional-konkreten Begriffen wie Bergführer, Reiseführer, Lokführer oder Fremdenführer erscheint er semantisch eindeutig, wertneutral und alltagspraktisch etabliert. Diese Zusammensetzungen bezeichnen klar definierte Rollen der Orientierung, Verantwortung und Anleitung ohne kultische oder autoritäre Elemente.
Die Vermeidung der isolierten Verwendung des Substantivs „Führer“ im Singular oder dessen Ersatz durch syntaktisch umständliche Konstruktionen wie Führungspersönlichkeit, Führungsverantwortlicher oder englischsprachige Entlehnungen ist historisch nachvollziehbar, aber linguistisch inkonsistent.
Historische Belastung und begriffliche Differenzierung
Der Begriff „Führer“ erfuhr durch den nationalsozialistischen Sprachgebrauch eine starke Belastung, insbesondere in der Verbindung mit dem Artikel der („der Führer“). Die Singularform erhielt durch ihre Verwendung im Dritten Reich eine symbolische Aufladung, die sie weitgehend aus dem neutralen Sprachgebrauch verdrängte.
Eine differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sprache erfordert jedoch eine Unterscheidung zwischen semantischer Kontamination und semantischer Unmöglichkeit. Historisch-politisch belastete Begriffe sind nicht grundsätzlich unbrauchbar, sondern erfordern eine präzise Kontextualisierung bei analytischer, nicht apologetischer oder ideologischer Intention. Der Jurist und Philosoph Carl Schmitt sprach in anderem Zusammenhang von Wörtern im Kampfzustand, die eine historische Entgiftung oder Umwertung benötigen. Die bewusste Rückgewinnung des Wortes „Führer“ stellt in diesem Sinne einen sprachlichen Akt der Verantwortung und Aufklärung dar, nicht der Verharmlosung.
Wissenschaftlich-systematische Begründung: Klarheit und Konsistenz
Aus systematisch-wissenschaftlicher Sicht ist der Begriff „Führer“ dem englischen „Leader“ oder der abstrakten Leadership überlegen, da er eine personale und relationale Dimension eindeutig enthält: Ein Führer bewegt, leitet und begleitet andere konkret, im Dialog mit Geführten, eingebettet in einen Raum von Verantwortung, Vertrauen und Richtung.
„Leadership“ ist ein Kollektivabstraktum, das in der Managementliteratur zwar produktiv, aber semantisch diffus verwendet wird. Es bleibt oft unklar, ob es sich um ein Persönlichkeitsmerkmal, einen Prozess, ein Idealfeld oder ein Sozialsystem handelt. Der Begriff „Führer“ drückt hingegen sprachlich präzise die Beziehung zwischen Person und Aufgabe aus. Darüber hinaus wirkt der Rückgriff auf englische Begriffe im deutschsprachigen Kontext oft terminologisch entleerend: Die Übernahme der Vokabel importiert eine damit verbundene kulturelle Matrix (u.a. das US-amerikanische Führungsverständnis), ohne diese kritisch auf die eigenen Kontexte hin zu reflektieren. Dies ist wissenschaftlich problematisch.
Juristische Unbedenklichkeit und Meinungsfreiheit
Aus juristischer Sicht besteht keine Einschränkung für die Verwendung des Begriffs „Führer“, sofern keine NS-Verherrlichung, Volksverhetzung (§130 StGB) oder sonstige strafrechtlich relevante Verwendungsweise beabsichtigt ist. Die Verwendung eines sprachlich legitimen Begriffs in einem klar definierten, nicht-ideologischen Kontext unterliegt dem Schutz der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 und 3 GG. Solange keine suggestive Verbindung zur NS-Ideologie hergestellt oder implizit aufrechterhalten wird, etwa durch ikonographische, sprachliche oder symbolische Verweise, ist der Begriff juristisch unbedenklich. Die wissenschaftliche Wiederaneignung eines durch Ideologien beschädigten Wortes kann als Beitrag zur sprachlichen Mündigkeit und zum kritischen Diskurs verstanden werden.
Hermeneutische Offenheit und sprachliche Rehabilitation
Sprache ist dynamisch, und Begriffe können, wie Theologie, Philosophie oder Soziologie zeigen, durch Diskurse rekontextualisiert werden. Die Entscheidung, den Begriff „Führer“ im Rahmen eines wertschätzenden, nicht-instrumentalisierten Verständnisses zu verwenden, bedeutet keine Restauration, sondern eine Rehabilitation im Lichte historischer Reflexion und begrifflicher Präzision.
Die Verwendung des Begriffs „Führer“ ist sprachlich gerechtfertigt, historisch verantwortungsvoll, juristisch zulässig und wissenschaftlich konsistent. Sie dient der Klarheit, begrifflichen Präzision und kulturellen Selbstverantwortung im Umgang mit der eigenen Sprache. Die bewusste Unterscheidung zwischen einem kultischen Führerbild und einem dienenden, begleitenden Führungsverständnis, das auf Bewegung, Orientierung und Beziehung basiert, ist dabei explizit zu machen und zu reflektieren.

Schreibe einen Kommentar