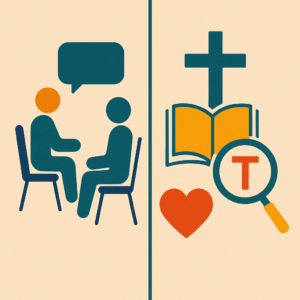
Ein Essay über Möglichkeiten, Konflikte und Grenzen eines interdisziplinären Dialogs
Moderne psychosoziale Beratung ist ohne Systemtheorie kaum vorstellbar. Systemische Ansätze prägen mit ihrer Beziehungsorientierung und ihrem ressourcenaktivierenden Potenzial Supervision, Familientherapie und Organisationsberatung. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach spirituell fundierter Begleitung, besonders in der christlichen Seelsorge. Dies führt zu der zentralen Frage: Ist systemische Beratung mit der christlichen Glaubenslehre vereinbar? Dieser Essay untersucht die Frage im interdisziplinären Dialog zwischen Theologie, Psychologie und Systemtheorie.
Systemische Beratung – eine konstruktivistische Perspektive
Systemische Beratung basiert auf der Annahme, dass menschliches Verhalten nur im Kontext sozialer Beziehungen verständlich ist. Sie verzichtet auf die Vorstellung des isolierten Individuums und betrachtet den Menschen als Teil dynamischer Interaktionen in familiären, beruflichen oder gesellschaftlichen Systemen (vgl. von Schlippe & Schweitzer 2012). Die Problemlage wird nicht dem Einzelnen zugeschrieben, sondern als Ausdruck eines kommunikativen Musters im Gesamtsystem verstanden.
Ein radikal konstruktivistisches Weltbild, das Wahrheit nicht als objektiv gegeben, sondern als subjektiv erzeugt betrachtet, liegt dem Ansatz zugrunde (vgl. Glasersfeld 1997). Diese Perspektive ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Beratung, da sie auf Bewertungen, Diagnosen und moralische Urteile verzichtet. Stattdessen stehen Hypothesenbildung, Perspektivenvielfalt und die Förderung von Selbstorganisation im Vordergrund.
Die christliche Glaubenslehre – Offenbarung und Wahrheit
Dem gegenüber steht das biblisch geprägte christliche Weltbild, das den Menschen als Geschöpf Gottes versteht, geschaffen im Bilde des Schöpfers (Gen 1,26), berufen zur Gemeinschaft mit ihm, aber auch als gefallener Sünder in einer heilsgeschichtlichen Wirklichkeit. Der christliche Glaube basiert auf einer Offenbarungswahrheit, nicht auf subjektiver Konstruktion. Jesus Christus bezeichnet sich selbst als „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). Wahrheit ist nicht relativ, sondern personal und göttlich begründet.
Zentrale Kategorien wie Schuld, Sünde, Erlösung, Gnade oder Heiligung stellen innerhalb der christlichen Glaubenslehre nicht verhandelbare Kernelemente dar. Sie besitzen eine soteriologische Tiefe, die in rein systemischer Betrachtung oft fehlt oder bewusst ausgespart bleibt. Christliche Seelsorge richtet sich deshalb nicht nur auf das „Funktionieren“ im System, sondern auf die innere Erneuerung des Menschen durch Christus.
Spannungsfelder zwischen systemischer Beratung und christlichem Glauben
Wahrheit vs. Konstruktion
Der radikale Konstruktivismus der Systemtheorie verträgt sich kaum mit der biblischen Vorstellung einer objektiv geoffenbarten Wahrheit. Während die Systemik betont, dass es keine überindividuelle Wahrheit gibt, sondern nur subjektive Wirklichkeitskonstruktionen, hält der christliche Glaube an der Gültigkeit göttlicher Gebote und an der historischen Wahrheit der Erlösungsgeschichte fest. Damit stehen zwei erkenntnistheoretische Paradigmen einander gegenüber.
Schuldvermeidung vs. Schuldbekenntnis
Systemische Beratung verzichtet in der Regel auf moralische Kategorien wie Schuld oder Verantwortung, um Stigmatisierung zu vermeiden. Sie spricht stattdessen von „Funktionen“ oder „Mustern“ in relationalen Kontexten. Die Bibel hingegen kennt das Bekenntnis von Schuld als entscheidenden Schritt zur Versöhnung mit Gott und dem Nächsten (1Joh 1,9; Ps 32). Wo Schuld nicht benannt wird, kann Gnade nicht konkret erfahren werden. Die Gefahr einer „billigen Gnade“ (Bonhoeffer 1937) ist real.
Erlösung durch Selbstorganisation?
Ein weiterer kritischer Punkt betrifft das Menschenbild. Die Systemik vertraut auf die Selbstorganisationskräfte des Individuums und des Systems. Die christliche Theologie geht davon aus, dass der Mensch Erlösung benötigt – von außen, durch Christus. Nicht Selbststeuerung, sondern göttliche Gnade transformiert letztlich das Herz des Menschen (vgl. Röm 5,1–5). Beratung darf diese Dimension nicht ignorieren, wenn sie dem ganzen Menschen gerecht werden will.
Chancen einer theologisch reflektierten Integration
Trotz dieser Spannungsfelder ist eine Integration systemischer Denkfiguren in die christliche Seelsorge möglich, unter der Voraussetzung, dass sie theologisch verankert und kritisch reflektiert bleibt.
Die systemische Beziehungsorientierung kann dazu beitragen, den Menschen nicht nur individuell, sondern in seinem familiären, kulturellen und kirchlichen Kontext zu verstehen. Die Betonung von Ressourcen, Lösungsmöglichkeiten und der Achtung der Autonomie lässt sich in biblischer Perspektive positiv aufnehmen, etwa im Blick auf die Gaben des Geistes (1Kor 12) oder die Verantwortung des Einzelnen vor Gott.
Wichtig ist jedoch, dass christliche Seelsorger die Grenzen des Systemischen erkennen und eine klare Unterscheidung zwischen methodischer Technik und theologischer Wahrheit vornehmen. „Systemisch denken – biblisch glauben“ könnte ein Leitsatz für eine reflektierte Nutzung systemischer Ansätze in seelsorgerlicher Praxis sein (vgl. Veeser 2008).
Quintessenz
Systemische Beratung ist kein Feind des Glaubens, aber auch kein Ersatz für das Evangelium. Sie kann Beziehungen verstehen, Muster erkennen und Lösungen entwickeln. Doch sie bleibt ein Werkzeug unter vielen und darf nicht zur Weltanschauung werden.
Dort, wo systemische Methoden einer biblisch fundierten Seelsorge dienen, wirken sie ergänzend und heilsam. Wo sie die Grundlagen des christlichen Glaubens relativieren, ersetzen oder entleeren, werden sie zum konkurrierenden Paradigma. Die Herausforderung besteht nicht in der Ablehnung, sondern in der kritischen Unterscheidung und in der Demut, Beratung stets an der Wahrheit des Evangeliums zu messen.
© Martin Haase
Literatur
- Bonhoeffer, D. (1937). Nachfolge. München: Chr. Kaiser Verlag.
- Glasersfeld, E. v. (1997). Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt: Suhrkamp.
- Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp.
- Simon, F. B. (2001). Einführung in die systemische Therapie und Beratung. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- von Schlippe, A., & Schweitzer, J. (2012). Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I–II. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schnepper, A. (2011). Systemische Beratung im Kontext christlicher Seelsorge. Wege zum Menschen, 63(4), 364–372.
- Veeser, W. (2008). Systemisches Denken und christlicher Glaube. Diakonia, 39(3), 170–177.
